3. Gemünden - Lebenswirklichkeit - komplett
3. Gemünden -Lebenswirklichkeit
„Eine brave Person befindet sich in bitterer Notlage“

Viele interne Unterlagen der jüdischen Gemeinden sowie die im preußischen Behördendeutsch „Jüdischer Kultus“ genannten Akten bei den Amtsverwaltungen sind in der Regel schon während der Reichspogrome 1938 vernichtet worden oder noch lange nach dem 2. Weltkrieg „verschwunden“. Einige Satzungen der jüdischen Gemeinden und überregionale Zeitungen des Judentums haben die Barbarei des NS-Staates überlebt und können einen Einblick in den ärmlichen Alltag vermitteln.
Die Kommunikation innerhalb der jüdischen deutschen Gemeinden war durch die relative Abgelegenheit der kleinen Gemeinden auf dem Hunsrück schwierig. Im heutigen Rhein-Hunsrück-Kreis konnte sich nach 1815 keine Gemeinde einen Rabbiner „leisten“, der in religiösen Rechtsfragen hätte entscheiden können. Die zunehmende Säkularisation und die wachsenden Assimilationsbestrebungen im 19. Jh. führten zu heftigen Debatten innerhalb des deutschen Judentums. Es ging u.a. um eine Reform des Gottesdienstes und der gesamten jüdisch-deutschen Kultur. Beispiele: Die Zulassung von Gesang oder Orgel im Gottesdienst oder die gleichberechtigte Bar oder Bat Mitzwa für Jungen und Mädchen, die in manchen Gemeinden in Anlehnung an die evangelische Begrifflichkeit als Konfirmation bezeichnet wurde. Überregionale Zeitschriften versuchten solche Fragen zu diskutieren und Orientierung zu bieten und auch Stellenanzeigen für Religionslehrer aufzunehmen oder auf besondere Notlagen hinzuweisen, z.B. beim Brand oder beim Neubau einer Synagoge. Hilfen für in Not geratene Familien gab es zwar durch eigene Vereine, in Gemünden die Chewra Kadisha („Heilige Gesellschaft oder Beerdigungsbruderschaft“, 1932 Vorsitzender Ludwig (Louis) Ochs) und der Jüdische Frauenverein (Vorsitzende 1932 Rosa Hammel), die bei Bestattungen, in der Wohlfahrtspflege sowie bei der Unterstützung hilfsbedürftiger Familien tätig waren.
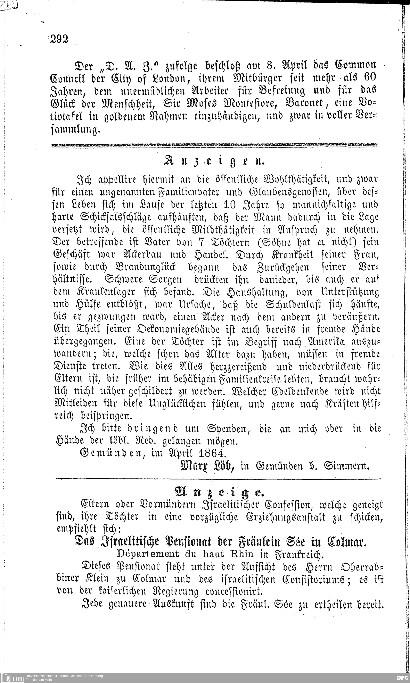
Die vielen Anzeigen der jüdischen Gemeinde Gemünden in der Zeitschrift „Der Israelit“ lassen Rückschlüsse zu auf ihre konservative Ausrichtung und die ärmlichen Lebensbedingungen. Die 1860 vom Rabbiner Dr. Markus Lehmann gegründete Wochenzeitschrift war bis zu ihrem Verbot 1938 das wichtigste Organ (ca. 4200 Exemplare) des deutsch-orthodoxen Judentums und verstand sich als Gegengewicht zur reform-orientierten „Allgemeinen Zeitung des Judentums“ und deren Nachfolger, der „CV-Zeitung“, Organ des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens.[1] Die auch von Gemünden zunächst bevorzugte Zeitung Jeschurun (frei übersetzt: „Der Rechtschaffene“), einem „Monatsblatt zur Förderung jüdischen Geistes und jüdischen Lebens, in Haus, Gemeinde und Schule“, wurde im Jahre 1889 mit „Der Israelit“ zusammenlegt.[2]
Anzeige im Jeschurun (Mai 1864) und fast gleichlautend in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. April 1864:
"Ich appelliere hiermit an die öffentliche Wohltätigkeit, und zwar für einen ungenannten Familienvater und Glaubensgenossen, über dessen Leben sich im Laufe der letzten 10 Jahre so mannigfaltige und harte Schicksalsschläge aufhäuften, dass der Mann dadurch in die Lage versetzt wird, die öffentliche Mildtätigkeit in Anspruch zu nehmen. Der betreffende ist Vater von 7 Töchtern (Söhne hat er nicht), sein Geschäft war Ackerbau und Handel. Durch Krankheit, sowie durch Brandunglück seiner Frau begann das Zurückgehen seiner Verhältnisse. Schwere Sorgen drückten ihn danieder, bis auch er auf dem Krankenlager sich befand. Die Haushaltung, von Unterstützung und Hilfe entblößt, war Ursache, dass die Schuldenlast sich häufte, bis er gezwungen war, einen Acker nach dem andern zu veräußern. Ein Teil seiner Ökonomiegebäude ist auch bereits in fremde Hände übergangen. Eine der Töchter ist im Begriffe nach Amerika auszuwandern; die, welche schon das Alter dazu haben, müssen in fremde Dienste treten. Wie dies alles herzzerreißend und niederdrückend für Eltern ist, die früher in behäbigem Familienkreise lebten, braucht wahrlich nicht näher geschildert zu werden. Edeldenkende werden Mitleiden für Unglückliche fühlen, die sich in solcher Lage befinden. Allenfallsige wohltätige Spenden bittet man an den Gefertigten einsenden zu wollen.
Gemünden, im April 1864. Marx Löb, in Gemünden bei Simmern."
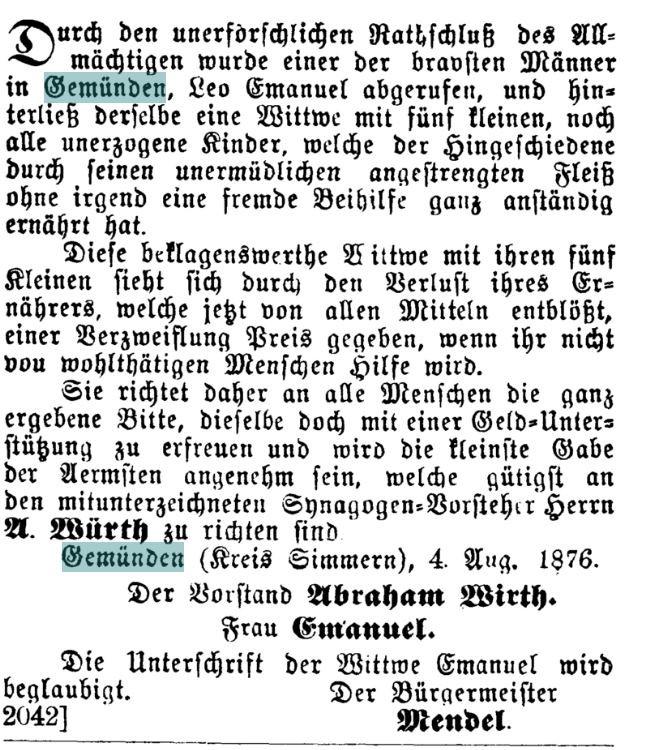
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. August 1876:
"Durch den unerforschlichen Ratschluss des Allmächtigen wurde einer der bravsten Männer in Gemünden, Leo Emanuel abgerufen, und hinterließ derselbe eine Witwe mit fünf kleinen, noch alle unerzogene Kinder, welche der Hingeschiedene durch seinen unermüdlichen angestrengten Fleiß ohne irgendeine fremde Beihilfe ganz anständig ernährt hat. Diese beklagenswerte Witwe mit ihren fünf Kleinen sieht sich durch den Verlust ihres Ernährers, welche jetzt von allen Mitteln entblößt, einer Verzweiflung Preis gegeben, wenn ihr nicht von wohltätigen Menschen Hilfe wird. Sie richtet daher an alle Menschen die ganz ergebene Bitte, dieselbe doch mit einer Geld-Unterstützung zu erfreuen und wird die kleinste Gabe der Ärmsten angenehm sein, welche gütigst an den mitunterzeichneten Synagogen-Vorsteher Herrn A. Wirth zu richten sind.
Gemünden (Kreis Simmern), 4. August 1876.
Der Vorstand Abraham Wirth. Frau Emanuel. Die Unterschrift der Witwe Emanuel wird beglaubigt. Der Bürgermeister Mendel."
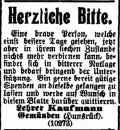
Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 24. April 1908:
"Herzliche Bitte.
Eine brave Person, welche einst bessere Tage gesehen, jetzt aber in ihrem siechen Zustande nichts mehr verdienen kann, befindet sich in bitterer Notlage und bedarf dringend der Unterstützung. Bin gerne bereit, gütige Spenden an dieselbe gelangen zu lassen und werde auf Wunsch in diesem Blatte darüber quittieren.
Lehrer Kaufmann, Gemünden (Hunsrück).
[1] Erschien 1837 bis 1922. Die CV-Zeitung 1922-1938, „Ein unpartheiisches Organ für alles jüdische Interesse in Betreff von Politik, Religion, Literatur, Geschichte, Sprachkunde und Belletristik“. Themen waren v.a. die Emanzipation und in den letzten Jahren der Kampf gegen Antisemitismus: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/3225281
[2] „Jeschurun“ als auch „Der Israelit“ sind fast vollständig im Internet einsehbar: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/2932754 und: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/2446951
